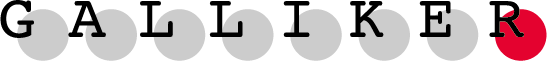Vertrauen zwischen der Bevölkerung und den Behörden ist auf jeder Staatsebene die Grundlage erfolgreichen politischen Handelns, ganz besonders auf Gemeindeebene, wo die direkte Demokratie besonders direkt gelebt wird. Damit Vertrauen entstehen kann, muss die Bevölkerung wissen, was die Behörden für sie tun. Dazu braucht es gute Kommunikation. War missachten immer wieder Behörden und Verwaltungen diese einfache Regel?
Ein Blog aus der Reihe «New Public Communications. Glaubwürdige Kommunikation in Gemeinden»
Mehrwert zu Blog 1 – anklicken und downloaden: Merkblatt Vertrauensaufbau
Dass Vertrauen die Grundlage erfolgreichen politischen Handelns ist, ist eigentlich eine Binsenwahrheit. Und doch wird diese Binsenwahrheit gerade auf kommunaler Ebene immer wieder in den Wind geschlagen. Wichtige Botschaften werden oft zu spät, zu knapp, zu trocken vermittelt, was bei der Bevölkerung zu Irritationen oder einer ablehnenden Haltung gegenüber einem wichtigen Geschäft führen kann.
In Krisenzeiten besonders sichtbar
Wie wichtig intensive und glaubwürdige Kommunikation für den Vertrauensaufbau ist, zeigte sich in der ersten Phase der Corona-Krise während des Lockdowns. Der Bund informierte rasch, klar und glaubwürdig. Er tat dies so überzeugend, dass trotz erheblicher Einschränkungen in die persönliche Freiheit kaum Widerspruch entstand. Die überwiegende Bevölkerungszahl hatte Vertrauen in den Bundesrat und folgte den Empfehlungen. Viel schwieriger wurde es, als der Bundesrat Lockerungen des strengen Corona-Regimes verfügte. Plötzlich bröckelte die vorher so grosse Einheit der obersten Schweizer Regierung. Differenzen wurden öffentlich ausgetragen. Schon schwand das Vertrauen in die Strategie des Bundes. Derzeit scheint der Bundesrat wieder Tritt gefasst zu haben. Die Informationen kommen aus einem Guss und schaffen Vertrauen.
Unterschiedliche Kommunikationskulturen in Gemeinden
Viele Gemeinden folgten dem Beispiel des Bundes. Sie informierten ihre Bevölkerung intensiv und schnell über die kommunalen Umsetzungen der Schutzmassnahmen. Auch die Lockerungen kommunizierten sie gut verständlich und flächendeckend. Sie erreichten mit ihren Online- und Printinformationen grosse Teile der Bevölkerung, weil sie bewährte Informations- und Kommunikationskanäle nutzen konnten. Sie eröffneten neue Informations- und Kommunikationsplattformen, um der Bevölkerung die Möglichkeit zu bieten, Hilfsangebote zu publizieren. Sie stärkten damit das Vertrauen in die Behördentätigkeit enorm. Manchen Gemeinden gelang dies nicht. Sie beschränkten ihre Informationstätigkeit auf das Nötigste und auch dies musste man auf der Gemeindewebsite noch suchen. Weitergehende Informationen seitens der Gemeinde, das geholfen hätten, das Leben der Bevölkerung und die Existenz des Gewerbes etwas zu lindern, blieben weitgehend aus. Das war wenig Vertrauensbildend in einer anspruchsvollen Zeit.
Zweiklassengesellschaft
Dasselbe Muster erleben wir auch in coronafreien Zeiten. Zwar gibt es kaum eine Gemeindepräsidentin oder einen Gemeindepräsidenten, der nicht den Wert guter Kommunikation mit der Bevölkerung betonen würde. Aber es gibt viele Gemeinden, in denen diesem Wert nicht nachgelebt wird. Im Prinzip erleben wir in Bezug auf die Kommunikation der Gemeindebehörden und der Gemeindeverwaltungen eine Zweiklassengesellschaft:
Die einen pflegen einen permanenten, lebendigen Dialog mit der Bevölkerung. Sie bieten verschiedene Dialogplattformen an, an denen das persönliche Gespräch gepflegt werden kann, und sie nutzen verschiedene Informationskanäle, um an die Bevölkerung zu gelangen. Sie stärken mit ihrer Kommunikationsstrategie das Vertrauen der Bevölkerung in die Behörden und die Verwaltung, denn die Bevölkerung kennt die Behördenmitglieder und die Kader der Verwaltung und weiss, für welche Werte diese stehen. Stehen anspruchsvolle oder kostspielige Geschäfte auf der Traktandenliste der Gemeindeversammlung, so hilft diese Vertrauensbasis, für das jeweilige Geschäft eine solide Mehrheit zu gewinnen.
Andere Gemeinden kommunizieren nach dem Vorbild einer eher langweiligen Berg- und Talbahn. Wenn die Behörden gerade nichts von der Bevölkerung wollen, so hört die Bevölkerung auch nichts von den Behörden. Zu berichten gäbe es schon etwas, zum Beispiel mit welchen Geschäften sich der Gemeinderat gerade befasst hat. Aber weil man darüber nicht aktiv informieren muss, informiert man auch nicht, oder so, dass es kein Mensch liest. Stehen Geschäfte an, für deren Bewilligung es eine Mehrheit an der Gemeindeversammlung braucht, wird die Information heraufgefahren. Aber auch nur mässig. An einer trockenen Informationsveranstaltung werden die wenigen Teilnehmenden, die sich einen solchen Abend antun, mit einem Folienregen berieselt, und das war’s. Mangelt es an der Gemeindeversammlung an Vertrauen für das trakandierte Geschäft, sind die Behördenmitglieder bass erstaunt. Schliesslich hat man im Vorfeld darüber informiert.
Vertrauensaufbau dank Kommunikationsstrategie
Vertrauen ist kein Selbstläufer. Das Fundament ist gute Arbeit der Behörden und der Verwaltung. Aber damit Vertrauen auf diesem Fundament entstehen kann, muss die Bevölkerung wissen, was die Behörden und die Verwaltung tun. Gemeinden, die wenig oder ungenügend kommunizieren, tun dies nicht aus böser Absicht oder Gleichgültigkeit. Meistens fehlt es an einer fundierten Strategie. Es lohnt sich, eine Kommunikationsstrategie in unbelasteten Zeiten zu entwickeln und Schritt für Schritt umzusetzen.